Kindgötter in Tempel und Siedlung: vom ägyptischen Götterkind zum multikulturellen Heilsbringer Thema: Rolle und Wandel ägyptischer Kindgötter vor dem Hintergrund der religiösen Interaktionen von Ägyptern, Griechen und Römern
Quellen: Tempeltexte und –bilder, Terrakotten und andere Zeugnisse der Kleinkunst
Raum: Ägypten in griechisch-römischer Zeit (332 v.Chr. – 395 n.Chr.)
Bisherige Arbeiten (vgl. die Publikationen von Budde, Sandri und Verhoeven):
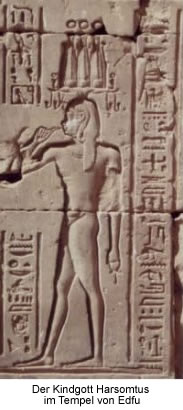 Dokumentation: Dokumentation:
- Aufnahme und Klassifizierung der Quellen
- Entwicklung der Analysemethoden
- Ikonographie, Wesen und Funktionen der Kindgötter:
- Kronen, Kleidung, Attribute, Körperhaltungen
- Einzelne Kindgötter:
- Har-pa-chered/Harpokrates
- Harpare-pa-chered
- Panebtaui-pa-chered
- Einzelne Motive:
- Das Kind auf der Lotosblume
- Der kindliche Sonnengott im Gehörn der Himmelskuh
- Das Kind im Tempel
- Das Kind auf dem Elefanten
- Das Kind im Boot
- Größere Studien:
- Die Hieroglyphen des Kindes im Schrift- und Dekorationssystem der griechisch-römischen Tempel (D. Budde)
- Das Götterkind im Tempel, in der Stadt und im Weltgebäude (D. Budde)
- Die Rolle der Kindgötter in den griechisch-römischen Mammisis (D. Budde)
- Ikonographie, Motivik und Bedeutung der Kindgott-Terrakotten (S. Sandri)
- Kulttopographie der Kindgötter (S. Sandri)
- Die lokale Kindgott-Verehrung in Ägypten (S. Sandri)
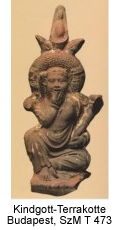 Geplante Untersuchungen: Geplante Untersuchungen:
Ausgehend von der Kindgott-Verehrung im griechisch-römischen Ägypten
soll die Funktion des Tempels im Leben der multikulturellen Bevölkerung
und des ansässigen Tempelpersonals vor dem Hintergrund bisheriger
Abgrenzungsvorstellungen näher untersucht und der erkennbare Wandel
religiöser Vorstellungen beleuchtet werden. Die neuen Tempelgebäude für
die Geburt des Götterkindes (Mammisi) stellen hierfür eine ebenso
breite Informationsquelle dar wie die zahlreichen gräko-ägyptischen
Terrakottafiguren, deren Varianz, geographische Verbreitung und
Interpretation im Zusammenhang mit einem dynamischen Kulturbegriff
genau zu analysieren ist.
|